Schüchtern, introvertiert oder hochsensibel?
- Solveig Jacobs
- 11. Aug. 2025
- 13 Min. Lesezeit
Ein sanfter Blick auf feine Unterschiede – und auf dich.
Vielleicht kennst du das Gefühl, dich manchmal wie „nicht richtig“ zu fühlen. Zu leise, zu ruhig. Vielleicht hast du dir schon unzählige Male anhören müssen:
„Du musst mehr aus dir herausgehen, wenn du etwas erreichen willst."
„Du musst dich mehr mündlich beteiligen, um deine Note zu verbessern.“

Egal ob du dich als schüchtern, introvertiert, hochsensibel oder einfach als „stilles Wasser“ bezeichnest – ich möchte dir gleich zu Beginn sagen: alleine bist du ganz sicher nicht! Es gibt viele Menschen, die ihre Welt leiser, tiefer und vielleicht auch langsamer erleben. Und genau darin liegt etwas Wertvolles.
In diesem Artikel lade ich dich ein, die Unterschiede zwischen diesen Begriffen zu entdecken. Nicht, um dich in eine Schublade zu stecken, sondern um dich selbst besser zu verstehen. Und um Wege zu finden, wie du im Einklang mit deinem Naturell leben kannst. Denn du entfaltest dein volles Potenzial erst, wenn du im Einklang mit deinem Naturell lebst und handelst.
Introversion – die Kraft der inneren Welt
Introvertierte Menschen suchen seltener äußere Stimulation. Sie tanken Energie in der Stille, in Momenten, in denen sie allein sind. Rückzug bedeutet für sie nicht Einsamkeit, sondern Auftanken und Erlebtes verarbeiten.
Typische Merkmale können sein:
ein hohes Bedürfnis nach Zeit für dich selbst
Energiegewinn im Alleinsein
Vorliebe für 1:1-Kontakte
zuhören statt reden
tiefes Nachdenken und Reflektieren
Stille als Ressource
Abneigung gegen überstimulierende Umgebungen
Vermeidung, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen
Vielleicht erkennst du dich darin wieder?
Als introvertierte Person kannst du möglicherweise auch extravertiert agieren, wenn es bestimmte Situationen erfordern. Nur kostet es dich viel mehr Energie.
Das Fehlen von stillen Inseln im Alltag bedeutet für introvertierte Persönlichkeiten schneller überstimuliert zu sein. Zu viele Gespräche, Geräusche oder soziale Situationen können dann erschöpfen.
Ein Blick auf das Big-Five-Modell - -
Die Begriffe Introversion und Extraversion wurden Anfang des 20. Jahrhunderts von C. G. Jung – einem Schweizer Psychologen und Psychoanalytiker – in die Persönlichkeitspsychologie eingeführt. Jung beobachtete, dass jeder Mensch angeborene, natürliche Persönlichkeitsmerkmale besitzt, die im Laufe des Lebens weitgehend konstant bleiben – unabhängig von Stimmung oder momentaner Einstellung.
Extraversion ist heute eine der fünf Persönlichkeitsdimensionen im sogenannten Big-Five-Modell. Dieses Modell basiert in seinen Grundgedanken auf Jungs Arbeiten und wird inzwischen sowohl in der Personalentwicklung von Unternehmen als auch im individuellen Coaching genutzt. Introversion bildet darin den Gegenpol zur Extraversion. Menschen, die im Big-Five-Modell einen sehr niedrigen Wert auf der Extroversionsskala haben, gelten als stark introvertiert.
Vielleicht ist dir schon aufgefallen: Im psychologischen Kontext liest man häufig das Wort extravertiert, während im Alltag oft extrovertiert verwendet wird. Beide Schreibweisen sind laut Duden korrekt – und gemeint ist dasselbe.
Während Extraversion eine nach außen gewandte Haltung beschreibt, steht Introversion für eine nach innen gerichtete Haltung – jeweils verbunden mit typischen Verhaltensweisen in sozialen Situationen. Introvertierte Menschen laden ihren „sozialen Akku“ oft dadurch auf, dass sie den intensiven Austausch mit Einzelpersonen suchen. Extravertierte hingegen fühlen sich durch lebendigen Kontakt in Gruppen energiegeladen und inspiriert.
Allerdings handelt es sich nicht um zwei Schubladen. Vielmehr bewegen wir uns alle auf einem breiten Spektrum zwischen diesen beiden Polen.
Die meisten Menschen befinden sich im mittleren Bereich – sie sind weder extrem extravertiert noch auffallend introvertiert – und passen ihr Verhalten flexibel an die jeweilige Situation an. Wenn beide Ausprägungen bei einer Person vorhanden sind, spricht man in der Psychologie von Ambiversion. Je nach Studie und Messinstrument geht man davon aus, dass 50 – 75 % aller Menschen zu dieser Gruppe gehören.
Exkurs: Die fünf Faktoren des Big-Five-Modells
Neben der Extraversion/Introversion beschreibt das Modell vier weitere Persönlichkeitsdimensionen:
Offenheit für Erfahrungen (Openness): Wie neugierig und einfallsreich ist jemand? Wie sehr liebt die Person Abwechslung?
Gewissenhaftigkeit (Conscientiousness): Wie zielstrebig, genau und pflichtbewusst ist jemand?
Verträglichkeit (Agreeableness): Wie rücksichtsvoll, kooperativ und empathisch ist jemand?
Neurotizismus (Neuroticism): Wie emotional labil oder verletzlich ist jemand?
Nimmt man die Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe, ergibt sich das Wort OCEAN – deshalb wird das Big-Five-Modell auch OCEAN-Modell genannt.
Ist Introversion angeboren oder erlernt?
Introversion entsteht aus einem Zusammenspiel von genetischer Veranlagung und Umwelteinflüssen. Es gibt Temperamente und Reaktionsweisen, die wir von Geburt an mitbringen. Schon bei Säuglingen lassen sich Unterschiede in Reizempfindlichkeit, Neugier und Annäherungslust beobachten. Diese frühen Eigenheiten sind Bausteine der Persönlichkeit, die wir später entwickeln.
Doch ebenso prägen uns die Erfahrungen in dem Umfeld, in dem wir aufwachsen – besonders in den ersten Lebensjahren. Ein feinfühliges, unterstützendes Umfeld und sichere Bindungserfahrungen können einem Kind helfen, seine Art zu verstehen und gut mit Reizen umzugehen. Frühkindlicher Stress oder Überforderung hingegen kann introvertiertes Verhalten verstärken – oder in manchen Fällen sogar kompensatorisch extravertiertes Verhalten fördern.
Neben der Persönlichkeit und dem Erziehungsstil der Eltern spielen weitere Faktoren wie Erfahrungen mit Geschwistern und Gleichaltrigen und prägende Ereignisse eine Rolle. Gene und Umwelt wirken dabei nicht isoliert, sondern beeinflussen sich gegenseitig.
So schaffen extravertierte Eltern – die gerne ausgehen, Freunde einladen oder Gruppenaktivitäten suchen – eine Umgebung, die Extraversion fördert. Introvertierte Eltern hingegen und die Art, wie sie mit ihrer eigenen Introvertiertheit umgehen – ob sie sie annehmen oder innerlich ablehnen – geben ihren Kindern andere Werte mit: im besten Fall Raum und Erlaubnis für Stille, Rückzug und Selbstreflexion.
Das prägt, wie wir als introvertierte Menschen später mit uns selbst umgehen und ob wir es wagen, nach unseren Bedürfnissen zu leben.
Exkurs: Biologische und neurochemische Unterschiede
Introvertierte und extravertierte Menschen unterscheiden sich nicht nur in ihrem Verhalten, sondern auch in Gehirnaktivität, Reizverarbeitung und der Funktionsweise ihres Belohnungssystems.
Cortical Arousal – der innere Lautstärkeregler
Die sogenannte Arousal-Theorie des Psychologen Hans Eysenck besagt: Introvertierte haben von Natur aus eine höhere neuronale Grundaktivität im Gehirn – selbst im Ruhezustand. Das bedeutet, ihr „innerer Lautstärkeregler“ für Wachheit und Reizverarbeitung ist bereits hoch eingestellt, auch wenn die Umgebung still ist. In sozialen Situationen oder lauten Umgebungen kann das schnell zu Überstimulation führen – und der Wunsch nach Rückzug wächst.
Extravertierte hingegen haben einen niedrigeren Grundpegel. Sie brauchen mehr „Input“ und äußere Reize, um sich wach und lebendig zu fühlen, und suchen deshalb bewusst Kontakt, neue Erlebnisse und belebte Umgebungen.
Damit wir uns wohlfühlen und leistungsfähig bleiben, brauchen wir alle ein „richtiges Maß“ an äußerer Stimulation – nur ist dieses Maß eben individuell sehr verschieden.
Eysencks Theorie hat einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsforschung geleistet, wird jedoch auch kritisiert, weil sie nicht konsistent ist und Umwelteinflüsse nicht ausreichend berücksichtigt.
Dopamin – das Belohnungssystem
Ein weiterer Unterschied liegt in der Reaktion auf Dopamin, oft auch „Glückshormon“ genannt.Dopamin wird ausgeschüttet, wenn wir angenehme äußere Reize erleben – es sorgt für Motivation, Antrieb und Zufriedenheit.
Der Unterschied:
Extravertierte benötigen mehr Dopamin, um die angenehme Wirkung von Dopamin zu spüren und sich stimuliert zu fühlen. Sie reagieren auch stärker auf äußere Belohnungen wie soziale Anerkennung, Applaus oder neue Erfahrungen.
Introvertierte reagieren empfindlicher auf Dopamin. Die gleiche Menge an Reizen, die für Extravertierte belebend wirkt, kann für sie schon zu viel sein.
Darum suchen viele Introvertierte ihre „Belohnung“ lieber in stilleren Aktivitäten: tiefen Gesprächen, konzentrierter Arbeit, Spaziergängen, Musik hören. Dabei spielt oft ein anderer Botenstoff eine Rolle – Acetylcholin.
Acetylcholin wirkt subtiler als Dopamin. Es wird mit einem Zustand von ruhiger Wachheit und Zufriedenheit in Verbindung gebracht. Es unterstützt genau jene Momente, in denen wir uns entspannt und gleichzeitig klar im Kopf fühlen – ein Gefühl, das viele Introvertierte besonders schätzen.
Reflexionsübung – Mein Energiekompass
„In welchen Momenten fühle ich mich lebendig und erfrischt – und wann leer und ausgelaugt?“
Nimm dir einen Moment Zeit, um diese Fragen zu beantworten. Notiere dir Situationen, die dir Kraft geben, und solche, die dich erschöpfen. Welche Räume brauchst du, um gut bei dir zu bleiben? Und wie klar kommunizierst du diese Bedürfnisse nach außen?
Was dir als introvertierte Persönlichkeit helfen kann
Vielleicht kennst du dieses Gefühl: Du bewegst dich in einer lauten, schnellen Welt – und immer wieder bekommst du zu hören, du seist „zu leise“ oder solltest „mehr aus dir herauskommen“. Manchmal ist das nur nervig. Manchmal kann es sich aber auch anfühlen, als würde deine Art nicht wirklich gesehen oder geschätzt.
Vielleicht haben dich schon deine Eltern dazu ermutigt, dich lauter und durchsetzungsfähiger zu zeigen – in der Annahme, dass Kinder, die eher in sich gekehrt, ruhebedürftig oder gar scheu sind, es später einmal schwer haben könnten. Möglicherweise hast du deshalb gelernt, dich in bestimmten Situationen anzupassen – Fähigkeiten zu entwickeln, die dir helfen, gehört und wahrgenommen zu werden. Das kann wertvoll sein. Doch wenn du dich immer häufiger erschöpft und ausgelaugt fühlst, könnte es Zeit sein, wieder mehr bei dir anzukommen.
Wenn du oft spürst, dass du über deine Grenzen gehst, ist das ein Hinweis darauf, dass du vielleicht noch nicht im Einklang mit deiner Introvertiertheit lebst. Vielleicht hast du dich bisher noch gar nicht bewusst als introvertiert betrachtet und möchtest herausfinden, wo du stehst. Dann kann es helfen, dir deine Stärken und Talente bewusst zu machen: Bist du kreativ? Kannst du gut zuhören? Bist du empathisch?
Denn wer sich selbst kennt und schätzt, kann auch anderen in ihrer Einzigartigkeit begegnen.
"Finde heraus, wer du bist, und tu es mit Absicht" - Dolly Parton
Ein unterstützendes Werkzeug dabei kann der LINC Personality Profiler sein – ein wissenschaftlich fundiertes Persönlichkeitsprofil auf Basis der Big-Five, das dir eine ganzheitliche und zugleich differenzierte Darstellung deiner Persönlichkeitsstruktur bietet:
Du erfährst deinen individuellen Skalenwert zwischen extravertiert und introvertiert.
Du kannst weitere feine Facetten deines Charakters benennen.
Du lernst mehr über deine Motive: Was treibt mich an? Warum tue ich, was ich tue?
Du kannst deine Kompetenzen klar benennen: Was fällt mir leicht? Wo liegen meine besonderen Stärken?
Wenn du spürst, dass ein Coaching mit dem LINC Profil für dich ein guter Weg sein könnte, um dich selbst besser zu verorten, dann lass uns sprechen.
Wenn du für dich bereits herausgefunden hast, dass du zu den introvertierten, ruhigen Menschen gehörst:
Plane bewusst Pausen und stille Kraftorte in deinen Alltag ein.
Kommuniziere deine Bedürfnisse nach Rückzug klar und wertschätzend.
Es werden nicht alle sofort verstehen, warum dir das wichtig ist – doch je klarer du deine Grenzen formulierst, desto eher werden sie akzeptiert. Und desto besser kannst du deine Energie im Alltag bewahren.
Schüchternheit – wenn Zurückhaltung zur Last wird
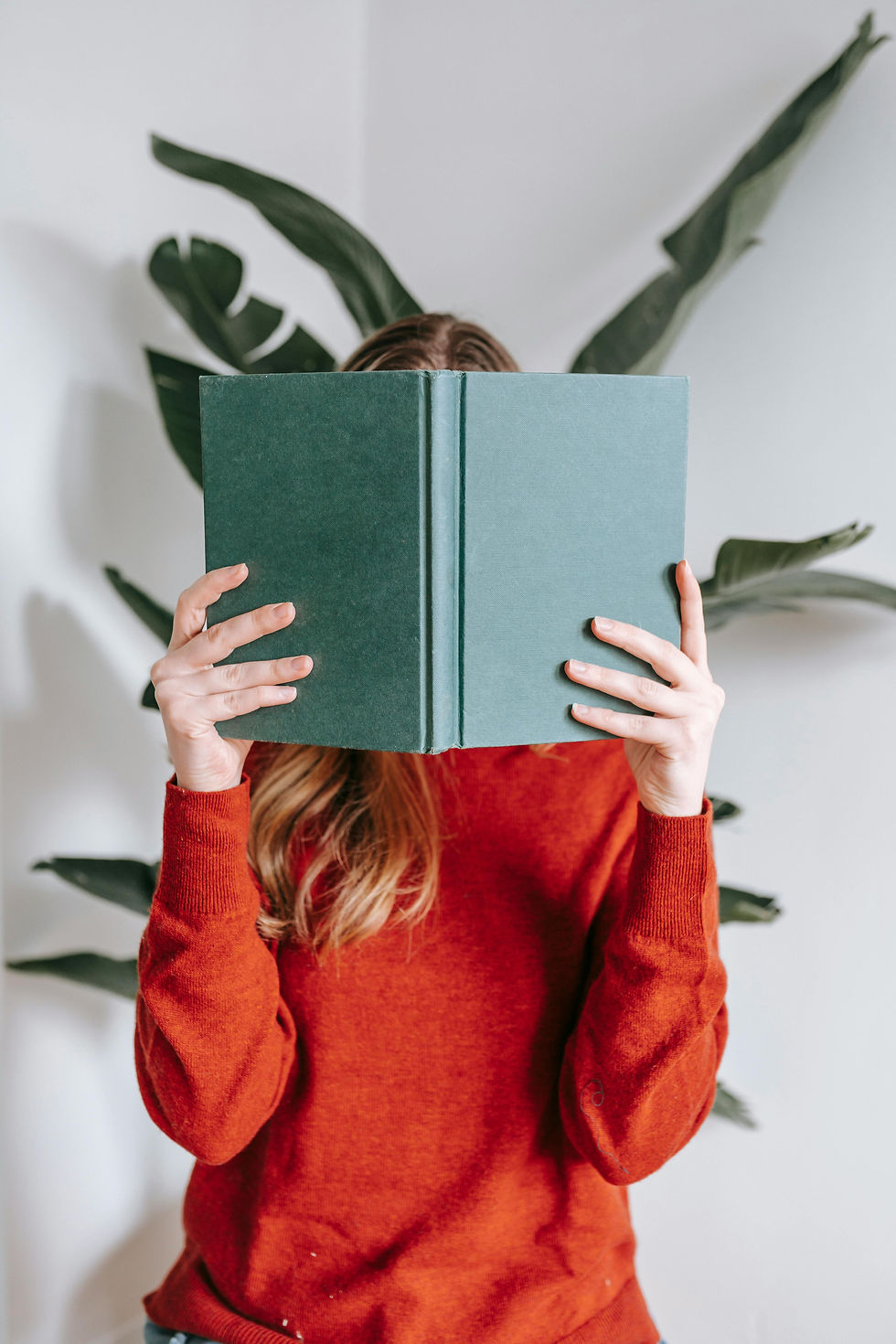
Schüchternheit ist etwas, das fast jeder Mensch in bestimmten Situationen schon einmal gespürt hat. Sie ist kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern ein erlerntes Verhalten – oft als Reaktion auf Erfahrungen, in denen wir uns bewertet, nicht verstanden oder abgelehnt gefühlt haben.
Schüchternheit ist nicht dasselbe wie Introversion. Es gibt schüchterne Extravertierte, die eigentlich gerne im Mittelpunkt stehen, aber in manchen Momenten vor Nervosität stocken. Und es gibt introvertierte Menschen, die in vertrauten Situationen sehr selbstsicher sind, aber in neuen Umgebungen schüchtern wirken.
Nicht selten entwickelt sich Schüchternheit bei sensiblen oder introvertierten Menschen, wenn ihre Talente und Fähigkeiten nicht erkannt oder sogar abgewertet wurden – sei es in der Schule, im Elternhaus oder im Umgang mit anderen. Schüchternheit steht häufig im engen Zusammenhang mit sozialen Ängsten und geht mit einem Mangel an Selbstvertrauen einher. Das Gefühl dahinter: „Ich könnte nicht genügen.“ oder „Was, wenn ich mich blamiere?“ Auch Schüchternheit und Scham hängen eng miteinander zusammen und Scham hat immer mit der Angst vor Zurückweisung zu tun.
Wie sich Schüchternheit zeigen kann
Schüchternheit ist ein vielschichtiges Erleben – und sie kann sich auf mehreren Ebenen bemerkbar machen:
Gedanklich kommt Schüchternheit immer dann, wenn du den Gedanken im Kopf hast, dass andere eine hohe Erwartungshaltung an dich haben und du denkst, du könntest enttäuschen. Überzeugungen wie „Ich kann keinen Smalltalk führen“, „Ich bin nicht interessant genug“ oder „Ich werde sicher rot“ setzen dich unter Druck.
Körperlich: Erröten, schwitzende oder zitternde Hände, Herzklopfen – das Schwierige ist, dass körperliche Symptome dem autonomen Nervensystem unterliegen und nicht willentlich steuerbar sind. Im Gegenteil, je mehr du versuchst, ein Nervositätssymptom zu kontrollieren, desto schlimmer wird es, weil es dadurch mehr Aufmerksamkeit erhält. Es kommt zu einer Negativ-Spirale. Oft verstärkt die Angst vor diesen Symptomen sie noch.
Im Verhalten führt Schüchternheit zu Rückzug, Schweigen oder Vermeidung von Situationen, in denen wir uns unwohl fühlen, weil vor allem die körperlichen Symptome vermieden werden wollen, die dir peinlich sind.
Auf der Gefühlsebene entstehen Angst und Scham durch das Gefühl, keine Kontrolle über seine Symptome zu haben oder wieder erlangen zu können.
Reflexionsübung – Woran du merkst, dass du schüchtern bist
Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe auf, in welchen Momenten du dich schüchtern fühlst. Häufige Anzeichen können sein:
· Verlegenheitsreaktionen
· Erröten
· Herzrasen
· Hemmungen, in Gruppen zu sprechen
· Grübeln vor oder nach sozialen Kontakten
· Angst vor Kritik oder Ablehnung
· Ständige Selbstbeobachtung („Wie wirke ich gerade?“)
Allein das Bewusstmachen dieser Signale ist ein wichtiger erster Schritt, um Schüchternheit zu verstehen – und liebevoll mit ihr umzugehen.
Wege zu einem neuen Umgang mit Schüchternheit
Die gute Nachricht ist: Schüchternheit lässt sich verändern. Nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt kannst du üben, dir mehr zuzutrauen und mutiger zu werden – wie ein Muskel, der mit jedem Training stärker wird.
Annehmen statt bekämpfen
Sieh deine Schüchternheit nicht als Feind, sondern als einen Teil von dir, der dich schützen will. Wenn du sie akzeptierst, verliert sie oft schon an Schärfe.
Raus aus der Vermeidung
Du kennst die Situationen, die dich fordern. Gehe bewusst kleine Schritte auf sie zu, statt sie zu umgehen.
Kleine Dosen, große Wirkung
Du musst nicht gleich ins Rampenlicht. Wähle Herausforderungen, die dich sanft dehnen, ohne dich zu überfordern. Wenn du beispielsweise üben willst, Leute anzusprechen, frage jemanden nach dem Weg. Wenn du Smalltalk-Situationen üben möchtest, such dir erstmal Einzelpersonen statt auf die große Gruppe zuzusteuern.
Neue innere Sätze
Entwickle unterstützende Glaubenssätze wie „Ich darf erröten und trotzdem weitersprechen“ oder „Ich bin liebenswert, auch wenn meine Hände zittern“.
Feiere Erfolge
Notiere jeden Tag kleine Fortschritte in einem „Erfolgstagebuch“.
Sei freundlich und nachsichtig mit dir
Sprich mit dir so, wie du mit einer guten Freundin oder einem guten Freund sprechen würdest. Besonders dann, wenn etwas nicht klappt.
Wenn Schüchternheit zur sozialen Phobie wird
Manchmal ist Schüchternheit einfach nur ein Teil unserer Persönlichkeit – ein leiserer Zug, der uns ausmacht. Doch wenn die Angst vor Bewertung oder Ablehnung sehr stark wird und zu einem dauerhaften Leidensdruck führt, kann daraus eine soziale Phobie entstehen.
Soziale Phobie ist eine psychische Störung. Sie geht oft mit einer intensiven Angst vor sozialen Kontakten einher – aus Sorge, sich zu blamieren, unangenehm aufzufallen oder negativ beurteilt zu werden.
Körperliche Symptome wie Herzklopfen, Zittern oder Schweißausbrüche verstärken die Angst noch, weil sie oft als „sichtbares Versagen“ empfunden werden. Manche Betroffene ziehen sich immer mehr zurück, meiden Gespräche, sagen Einladungen ab – und geraten so in eine Art selbst verstärkende Isolation.
Wenn du unsicher bist, ob du „nur“ schüchtern bist oder ob es schon in den Bereich einer sozialen Phobie geht, gilt: Scheue dich nicht, Unterstützung zu suchen. Ein geschulter Blick von außen kann helfen, klarer zu sehen und gezielt Schritte zu gehen, die dir Erleichterung bringen.
Gehemmtheit und Ängstlichkeit
Gehemmtheit beschreibt ein Verhalten, das geprägt ist von Zurückhaltung, Zögern oder übermäßiger Vorsicht. Ängstlichkeit ist eher ein innerer Zustand – eine emotionale Reaktion, die sich oft auch körperlich zeigt: durch Muskelanspannung, Nervosität oder Herzklopfen. Beides kann aus frühen Erfahrungen, der Erziehung oder inneren Glaubenssätzen entstehen.
Typische Folgen sind:
· Entscheidungsunfähigkeit
· Rückzug aus neuen Situationen
· Passivität, um mögliche Risiken zu vermeiden
Sanfte Unterstützungsmöglichkeiten
Wenn du das Gefühl hast, dass dich deine Ängstlichkeit stark einschränkt, gibt es Wege, wieder mehr Sicherheit und Bewegungsfreiheit zu gewinnen:
Entspannungsverfahren wie progressive Muskelrelaxation helfen, körperliche Symptome zu regulieren.
Achtsamkeitsübungen unterstützen dich dabei, im Moment zu bleiben und nicht in gedankliche Negativspiralen abzurutschen.
Coaching oder Therapie kann dich begleiten, deine inneren Ressourcen zu entdecken, deine Entscheidungen klarer zu treffen und dich selbst in herausfordernden Situationen zu stärken.
Du musst diesen Weg nicht allein gehen – Unterstützung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein mutiger Schritt hin zu mehr innerer Freiheit.
Hochsensibilität – wenn deine Sinne feiner wahrnehmen

Hochsensibilität ist keine Modeerscheinung, sondern eine angeborene Eigenschaft. Sie bedeutet, dass dein Nervensystem Reize – ob Geräusche, Stimmungen oder Gerüche – intensiver aufnimmt und tiefer verarbeitet als bei den meisten Menschen. Das kann wunderschön sein: Du erlebst Details, die anderen entgehen, spürst Stimmungen sehr genau, kannst dich in andere Menschen einfühlen. Gleichzeitig kann es emotional und körperlich anstrengend werden, wenn die Reize zu zahlreich oder zu stark sind.
Der Begriff „Highly Sensitive Person“ (HSP) wurde in den 1990er-Jahren von der Psychologin Elaine Aron geprägt. Sie bezeichnete die Eigenschaft „Sensory Processing Sensitivity“ (SPS) als prägendes, angeborenes Merkmal, über das rund 15-20% der Menschen verfügen.
Hochsensible Menschen können sowohl introvertiert als auch extravertiert sein – Hochsensibilität ist also nicht dasselbe wie Introversion. Studien zeigen, dass rund ein Drittel der Hochsensiblen extravertiert ist.
Typische Anzeichen von Hochsensibilität
Reizüberflutung & Überstimulation
Erschöpfung nach Meetings, Großraumbüros, Feiern oder Reisen
Konzentrationsprobleme bei Lärm oder Hektik
Körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Herzrasen, Anspannung
Emotionale Tiefe & Empathie
Intensives „Mitfühlen“ mit anderen
Schwierigkeiten, dich abzugrenzen – vor allem bei Konflikten oder Trauer
Tendenz zu Selbstzweifeln oder innerem Grübeln
Geringere Stressresistenz
Überforderung bei Zeitdruck, Multitasking oder Leistungsdruck
Probleme mit spontanen Veränderungen und Unsicherheiten
schnelleres Erreichen der Belastungsgrenze
Selbstkritik & Perfektionismus
Hohe Ansprüche an dich selbst
Häufiges Grübeln über vermeintliche Fehler
Angst vor Kritik oder Bewertung
Soziale Herausforderungen
Überforderung durch Small Talk oder große Gruppen
Missverstanden werden („zu sensibel“, „zu emotional“)
Rückzugsbedürfnis wird fälschlich als Desinteresse gedeutet
Schwierigkeit beim Abgrenzen & „Nein“-Sagen
Überanpassung aus Rücksichtnahme oder Harmoniebedürfnis
Zu wenig Raum für deine eigenen Bedürfnisse
Gefühl des „Ausgeliefertseins“ in sozialen oder beruflichen Situationen
Digitale Reizüberflutung
Unruhe, Nervosität oder Schlafprobleme nach langer Bildschirmzeit
Sehnsucht nach Digital Detox oder bewusster Stille
Innere Unruhe durch Dauerkommunikation
Nicht alle hochsensiblen Menschen erleben alle diese Punkte. Aber vielleicht erkennst du dich in einigen davon wieder – und kannst dadurch beginnen, liebevoller mit dir umzugehen.
Reflexionsübung – Meine Reizlandkarte
Nimm dir ein Blatt Papier und zeichne einen Kreis.
Schreibe hinein oder drum herum alle Reize, die dich im Alltag stressen – Geräusche, Licht, Menschenmengen, Gerüche. Was davon kannst du beeinflussen? Welche Strategien hast du, um dich zu regulieren? Wo möchtest du bewusster Grenzen setzen?
Schon allein diese Bestandsaufnahme kann dir helfen, Klarheit zu gewinnen und gezielter für dich zu sorgen.
Außerdem verlinke ich dir hier gerne die Seite von Elaine Aron, über die du einen computergestützten Online-Test erhalten kannst: www.HSPerson.com
Wie du Hochsensibilität als Stärke leben kannst
Selbstakzeptanz. Wenn du dir sagen kannst: „So bin ich – und das ist gut so“, fällt es leichter, deine Sensibilität als Gabe zu sehen. Hochsensibilität bringt wertvolle Eigenschaften mit sich – Kreativität, Empathie, Werteorientierung. Alles Qualitäten, die in unserer Welt dringend gebraucht werden.
Nutze deine Ressourcen bewusst: Stille, Spaziergänge, Musik, Atempausen.
Trainiere deine Wahrnehmungssteuerung: Lasse bestimmte Reize bewusst zu und reduziere sie wieder, um dein persönliches Wohlfühlmaß zu finden.
Beobachte dich selbst: „Wie fühle ich mich an bestimmten Orten oder mit bestimmten Menschen?“
Passe deinen Alltag an: Plane Pausen, gönne dir Rückzugszeiten, setze klare Grenzen.
Verwende mentale Anker: „Ich bin sicher, auch wenn es um mich herum laut ist.“
Finde körperorientierte Methoden zur Beruhigung, z. B. bewusstes, tiefes Atmen.
Hochsensibilität ist kein Hindernis – sie ist ein Geschenk.
Die Kunst besteht darin, deine feinen Sinne zu schützen, ohne sie zu verschließen.
Takeaway – für dich zum Mitnehmen
Wenn du dich früher gefragt hast: bin ich introvertiert, schüchtern oder hochsensibel?
Introversion, Schüchternheit und Hochsensibilität sind keine Mängel, die „behoben“ werden müssen. Sie sind Ausdruck deiner Persönlichkeit – Facetten, die dich einzigartig machen. Die Unterscheidung dieser Begriffe ist keine akademische Spielerei, sondern eine Einladung, dich selbst (und andere) besser zu verstehen. Nicht jede Schüchternheit braucht Therapie. Nicht jede Hochsensibilität muss „reduziert“ werden. Aber jedes Verhalten verdient es, verstanden zu werden.
Wenn du beginnst, dich so anzunehmen, wie du bist, verändern sich auch die Worte, mit denen du dich beschreibst. Plötzlich kann „auf die leise Weise“ oder „feinfühlig“ etwas Positives sein – etwas, das dich ausmacht.
Wenn du merkst, dass dich Schüchternheit zu stark einschränkt oder Hochsensibilität dich überfordert, dann gibt es heute viele Wege, um damit umgehen zu können. Wichtig ist, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich bestärken – und dir den Mut geben, deinen eigenen Weg zu gehen.
Wenn du auf diesem Weg Unterstützung suchst, begleite ich dich gern. Manchmal reicht schon ein neutraler Blick von außen, um neue Perspektiven zu öffnen und Stärken sichtbar zu machen, die du selbst vielleicht kaum noch wahrnimmst.
„Sich selbst treu zu sein in einer Welt, die ständig versucht, aus dir etwas anderes zu machen, ist die größte Leistung.“ – Ralph Waldo Emerson



Kommentare